Wie KI der Pharmabranche auf die Sprünge helfen kann
Ob es um neue Wirkstoffe gegen SARS-CoV-2, die Suche nach Pflanzen mit Anti-Malaria-Eigenschaften oder die Überwachung der Produktion von Medikamenten geht: Künstliche Intelligenz (KI) kann als Werkzeug zu einer deutlich beschleunigten und treffsicheren Entscheidungsfindung beitragen, wie aktuelle Beispiele zeigen.

Zu Beginn der Pandemie hatte man eine Idee: Durch eine Art Wettbewerb sollte es Forschenden schmackhaft gemacht werden, mittels KI nach chemischen Verbindungen zu suchen, die als potenzielle Medikamente den sich ausbreitenden Infektionen entgegenwirken könnten. Weltweit durchforsteten daraufhin 31 Teams Milliarden möglicherweise hilfreicher Moleküle, wovon letztendlich 27 Wirkung gegen SARS-CoV-2 zeigten. Der Einsatz von KI als Wegweiser war also erfolgreich.
„Wir leisten Vorarbeit in einem sehr frühen Stadium, in dem die KI bewertet, welche Moleküle vielversprechend sind und welche nicht. So kann man diesen riesigen Pool an Wirkstoffen schon mal vorfiltern“, erklärt Johannes Schimunek vom Institut für Machine Learning der Universität Linz und Erstautor einer auf der „Billion molecules against Covid-19 challenge“ basierenden Publikation, gegenüber APA-Science. Schließlich sei ein umfassendes experimentelles Testen all dieser chemischen Verbindungen im Labor gar nicht möglich. KI-Methoden könnten beim Vorsortieren und Filtern helfen und damit die Anzahl an tatsächlichen Versuchen reduzieren.
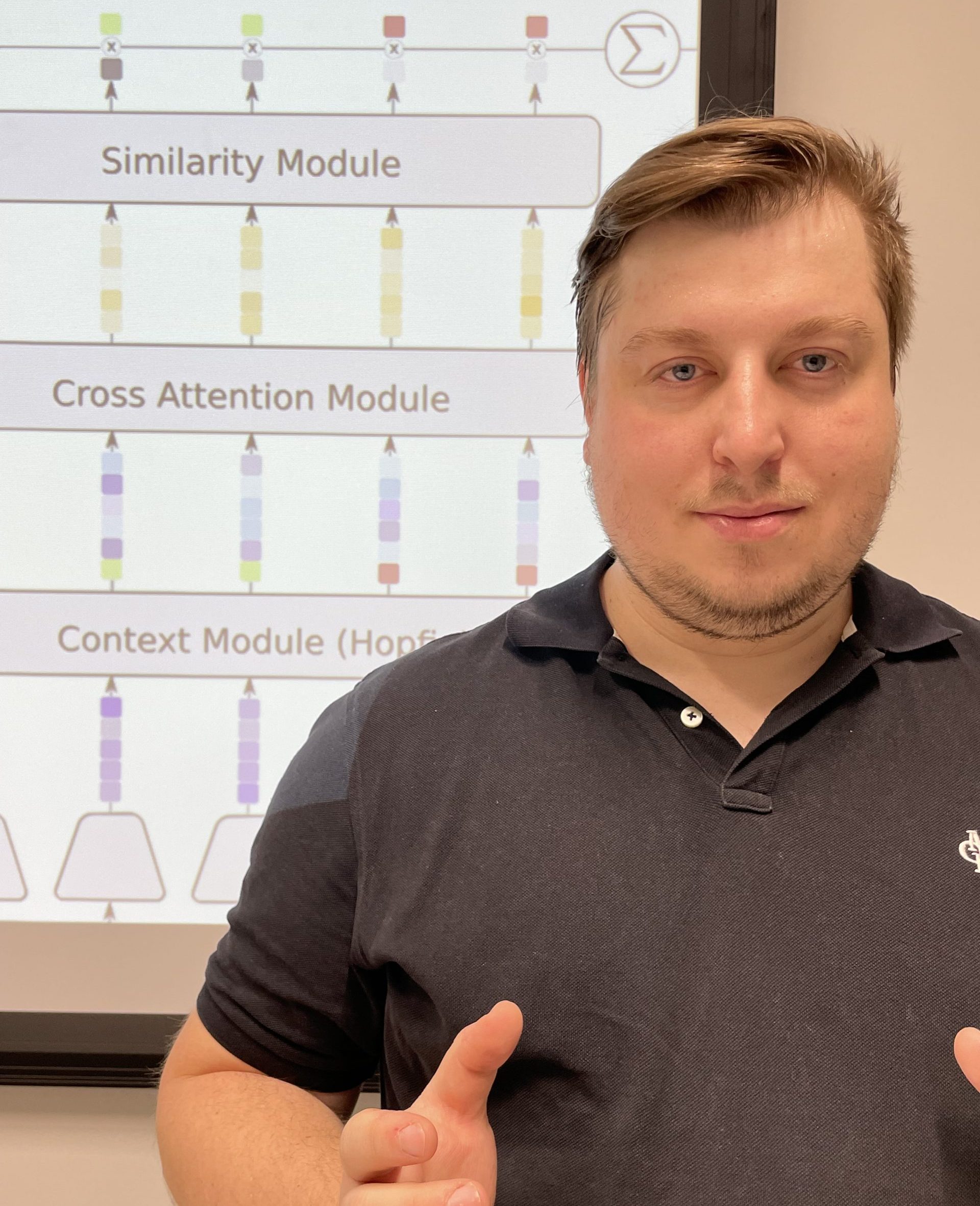
Daten als Flaschenhals
Oft seien die Daten hier ein Flaschenhals. „Eine KI kann nicht zaubern – im Sinnen von Wissen aus nichts generieren. Vielmehr erkennt die KI Muster, die in den Daten versteckt und für uns Menschen vielleicht nicht sichtbar sind. In spezifischen Situationen stehen ausreichend Daten zur Verfügung“, so der Experte. Am Beginn der Pandemie habe es aber noch kaum Informationen über SARS-CoV-2 gegeben. Eine in solchen Fällen anwendbare Strategie sei das „Few-shot learning“, also das Lernen anhand von wenigen Daten beziehungsweise die Nutzung von vorhandenem Wissen aus anderen (verwandten) Fragestellungen. „Die KI muss in den Daten Gesetzmäßigkeiten entdecken und Strategien entwickeln, um vorhandenes Wissen intelligent zu nutzen und eine Lösung für die eigentliche Fragestellung zu finden“, erläutert Schimunek.
Ein weiterer Trend geht zu multi-modalen Modellen, die Wissensquellen bündeln und viele verschiedenen Inputs – von Molekül-Strukturen über Text bis zum Bild – nutzen, um so viel „Lernstoff“ wie möglich zu haben. Würde ein Modell die Struktur der Wirkstoffe kennen und zusätzlich Information erhalten, wie die Wirkung in der Zelle konkret aussieht, könnte es „mehr Chemie lernen“, was wiederum zu besseren Voraussagen führe. Auch so genanntes „Active Learning“ finde größere Verbreitung. Dabei schlägt die KI den Forschenden vor, welche Moleküle getestet werden sollten, um das Modell durch das Training auf das neue Wissen zu verbessern.
ChatGPT „keine allwissende KI“
Vom Hype rund um Programme wie ChatGPT will sich Schimunek nicht anstecken lassen: „Man darf sich das nicht als allwissende KI vorstellen. Ich bin da eher auf der konservativen Seite, wenn von disruptiven Systemen gesprochen wird.“ Richtig sei aber, dass Chatbots die Zusammenarbeit zwischen KI und Forscher erleichtern würden, wenn Wissen in natürlicher Sprache abgefragt werden könnte. Auch im Arbeitsprozess gebe es Vorteile: „Wir definieren das Ziel, und die KI plant die Teilschritte, führt sie selbstständig aus und nutzt dafür bestimmte Werkzeuge“, kann sich der Experte vorstellen.
Beim SARS-CoV-2-Projekt wurden letztendlich von insgesamt 639.024 von den Teams vorgeschlagenen potenziell aktiven Molekülen 878 besonders vielversprechende chemische Verbindungen in Laborversuchen getestet, 27 Moleküle zeigten Aktivität, respektive Wirkung gegen das Virus. Rund die Hälfte davon, konkret 14, fand sich auch auf der insgesamt 67 Einträge umfassenden Liste des Linzer Forschungsteams. Der Weg zum fertigen Medikament sei da aber noch sehr weit. Die Pharmaunternehmen müssten unter anderem noch dafür sorgen, dass die Moleküle hinsichtlich anderer Charakteristika sinnvoll einsetzbar und beispielsweise nicht toxisch sind.
Pflanzen für Malaria-Medikamente
Auch bei der Suche nach Pflanzen mit Anti-Malaria-Eigenschaften kann Künstliche Intelligenz hilfreich sein, wie ein internationales Forschungsteam in einer Studie im Fachblatt „Frontiers in Plant Science“ zeigt. Mithilfe einer neuen Methode, die auf maschinellem Lernen basiert, konnten in kurzer Zeit mindestens 1.300 Arten mit Anti-Malaria-Eigenschaften entdeckt werden, die mit herkömmlichen Methoden nicht gefunden worden wären, so die Forschenden.
Als reiche Quelle bioaktiver Substanzen haben Pflanzen auch in der Vergangenheit die Grundlage für die Entwicklung zahlreicher Medikamente geliefert. Da es aber schätzungsweise 343.000 verschiedene Arten von Gefäßpflanzen gibt, kann die Identifizierung von Pflanzen mit Anti-Malaria-Wirkstoffen zeitaufwendig und kostspielig sein. In der Studie wurden 21.000 Arten aus drei Pflanzenfamilien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass 7.677 der Arten genauer unter die Lupe genommen werden sollten. Knapp jede Sechste davon wäre mit konventionellen Methoden übersehen worden.

Qualitätskontrolle in der Pharmaproduktion
In der Produktion von Medikamenten kann KI ebenfalls wertvolle Dienste leisten, wie Wirtschaftsinformatiker der Universität Graz zeigen. In einer Kooperation mit dem Pharma-Unternehmen Fresenius Kabi Austria wurde nachgewiesen, dass eine automatisierte Entscheidungsfindung in der Qualitätskontrolle – eine hochsensible Aufgabe – die erforderlichen Standards gewährleisten kann.
Konkret geht es dabei um die Überwachung eines Fließbands, auf dem kleine Abfüllfläschchen in einem abgesicherten Glastunnel transportiert werden. Fällt beispielsweise ein Fläschchen um, können die Mitarbeiter durch große Gummihandschuhe in die Produktionslinie eingreifen. Stellt eine dritte Person anhand des Videomaterials eine kritische Aktion fest – wenn die Hand etwa zu nah an die Fläschchen kommt und diese potenziell kontaminiert – müssen die Arzneimittel sicherheitshalber ausgesondert werden.
„Das zu überwachen ist für Menschen sehr eintönig und auch relativ aufwendig“, erklärt Stefan Thalmann vom Business Analytics and Data Science-Center der Universität Graz gegenüber APA-Science. KI-Modelle seien hingegen gerade bei diesen visuellen Inspektionen traditionell sehr stark. Im Rahmen der Umsetzung habe man Methoden der sogenannten „erklärbaren KI“ („Explainable AI“), also eine Erklärungsfunktion, eingeführt, um eine Blackbox-Problematik zu vermeiden. Das wäre beispielswiese der Fall, wenn es keine exakten Entscheidungsregeln gebe, sondern ein neuronales Netz selbstständig aus den Trainingsdaten lerne.
Sobald die KI einen kritischen Eingriff feststelle, würden auf den Bildausschnitten die kritischen Elemente rot und die anderen grün hinterlegt, wodurch die Entscheidung nachvollziehbar werde. Das sei intensiv getestet worden. So habe man Daten eingespielt, die Grenzfälle darstellen, und überprüft, ob die KI alles entdeckt. „Außerdem haben wir uns angesehen, ob das KI-System wirklich die richtigen Bildausschnitte hernimmt, um die Bewertung vorzunehmen“, so der Grazer Wissenschafter. Tatsächlich seien dadurch Trainingsfehler entdeckt worden.

Erklärungsfunktion zeigt Trainingsfehler
Wurde mit zwei Handschuhen eingegriffen, habe die KI das automatisch als kritisch eingestuft. In der Erklärungsfunktion zeigte sich, dass die beiden Löcher zum Durchgreifen rot detektiert wurden. Dieser Ausschnitt sei aber im Gegensatz zum Bereich am Fließband nicht relevant gewesen. „Der Grund war, dass die Eingriffe mit zwei Handschuhen in den Trainingsdaten immer kritisch waren. Also haben wir neue Bilder mit zwei Handschuhen erstellt, die kein kritischer Eingriff waren und darauf wurde wieder trainiert“, so Thalmann. Dadurch sei von der KI schließlich auf die wichtigen Aspekte geachtet worden.
Die Ergebnisse habe man mit allen erdenklichen Situationen über einen relativ langen Zeitraum immer wieder getestet und jede Entscheidung erneut validiert, um eine hohe Sicherheit zu garantieren und eine Zertifizierung zu erreichen. Das fertige KI-Modell sei aufgrund der sehr hohen regulatorischen Standards natürlich nicht einfach auf andere Bereiche oder Produktionsanlagen übertragbar, sehr wohl aber das entwickelte Prozessmodell, mit dem man die Grenzfälle betrachten kann.
Auswirkung auf Mitarbeiter und Arbeitspraktiken
In einem aktuellen Projekt soll nun untersucht werden, welche Effekte der Einsatz der KI hat. Früher seien nach einem Eingriff des Beschäftigten die betroffenen Proben aus dem Zeitfenster zur Seite gestellt und die Videosequenzen von einer externen Person überprüft und beurteilt worden. „Jetzt passiert das direkt und es gibt auch ein direktes Signal an den Mitarbeiter, dass das kritisch war und die Sachen aussortiert werden. Da war die Frage, was das mit den Mitarbeitern macht und wie es die Arbeitspraktiken ändert“, so Thalmann. Aktuell würde mit Interviewstudien ein Vorher-Nachher-Bild erhoben, inwieweit die KI in der Praxis für Veränderungen gesorgt hat.
Generell berge KI großes Potenzial für die pharmazeutische Industrie. Allerdings sei eine Einführung aufgrund der hohen Hürden sehr aufwendig. „Es ist gut, dass man in der Durchführung eher vorsichtig und konservativ ist. Aufgrund der Regulatorik sehe ich jedenfalls keine Systemumbrüche, sondern eher eine graduelle Verbesserung in vielen Bereichen“, betont der Experte.
