Künstliche Intelligenz und virtuelle Netze gegen seltene Krankheiten
Computeralgorithmen demütigen heute jeden menschlichen Großmeister am Schachbrett, lenken Autos, führen Gespräche und enervieren Internetbenutzer mit Werbeanzeigen. Sie können auch Medizinern bei der Diagnose helfen, Medikamente designen und Therapien anraten, so Expertinnen und Experten. Virtuelle Plattformen, Krankengeschichteregister und internationale Datenbanken ermöglichen auch, für die Behandlung seltener Krankheiten kollegiale Expertise, Vergleichsfälle und Vorgeschichten einzuholen.
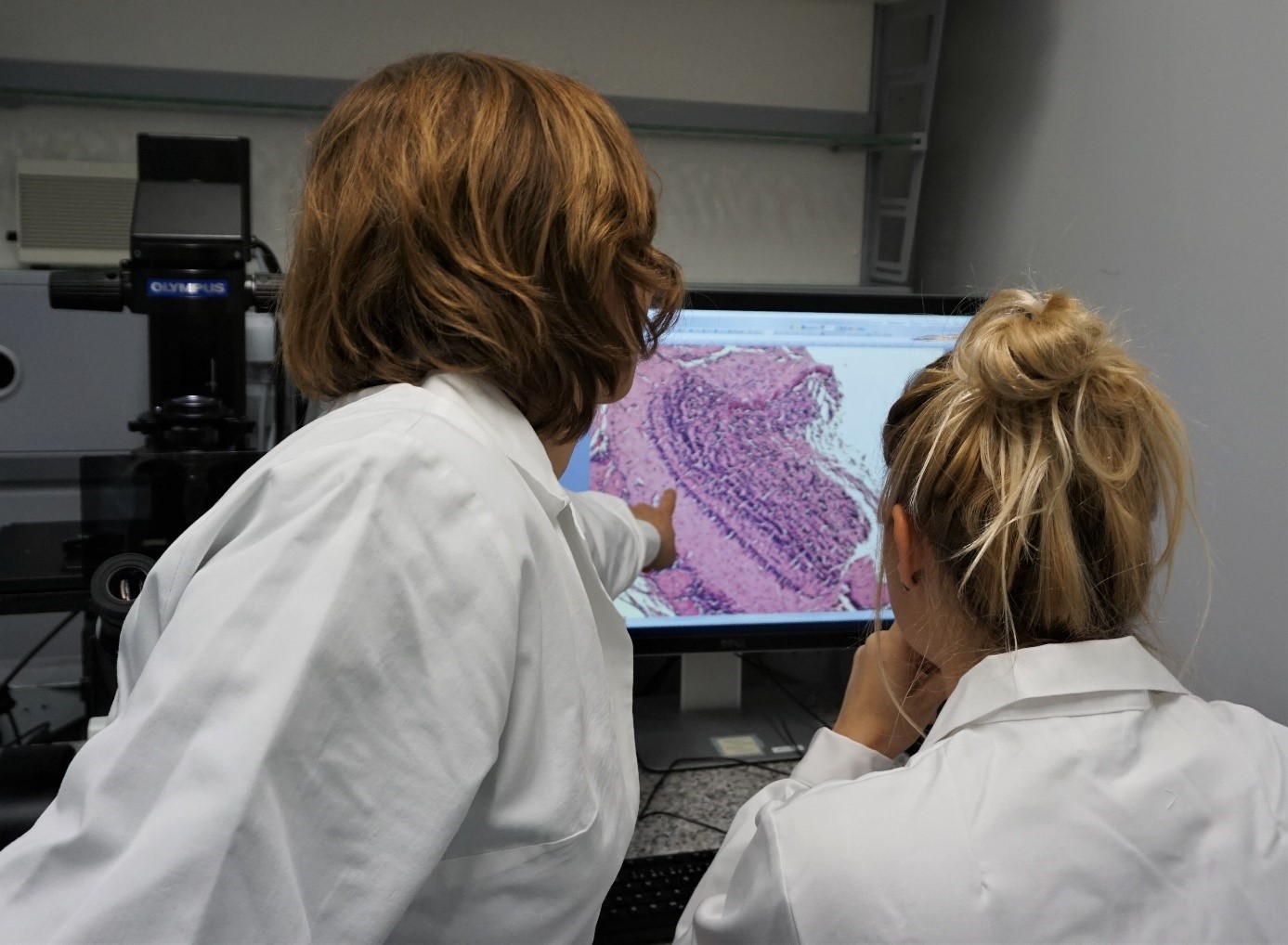
Diagnosen durch künstliche Intelligenz
„Ich glaube, dass grundsätzlich künstliche Intelligenz in der Medizin super ist, um den Ärztinnen und Ärzten zu helfen, die Diagnosen langfristig zu verbessern“, sagt die Biologin und Bioinformatikerin Susanne Kimeswenger von der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie der Universität Linz: „Das gilt auch für die seltenen Erkrankungen, wenn man ein bisschen langfristiger denkt.“ Sie selbst untersuchte zunächst mit Kollegen bei häufigeren Krankheiten, ob ein Computer basierend auf Bildern von Gewebeproben (histologischen Bildern) Diagnosen erstellen kann. Es funktionierte. „Wir fokussieren nun mehr auf seltene Erkrankungen, und zwar sowohl deren Diagnose als auch neue Therapien“, erklärt sie: „Eines unserer aktuellen Projekte ist die Erkennung eines sehr seltenen Hautkrebstyps, und zwar des kutanen T-Zell-Lymphoms, mittels künstlicher Intelligenz.“ Die Forscher wollen künstliche neuronale Netzwerke dahingehend trimmen, dass sie diese „Tumorentität“ in histologischen Bildern feststellen. Das ist nicht trivial, weil die Symptome zunächst ähnlich wie bei entzündlichen Hauterkrankungen sind. „Es ist aber sehr wichtig, diesen Krebstypus schon sehr bald zu erkennen, weil dann die Therapiemöglichkeiten viel besser sind, als in späteren Stadien“, so die Expertin.
Kleine Datenmengen durch geringe Fallzahlen
„Für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ist es natürlich immer wichtig, dass man einen großen Datensatz hat, um den Computer daran zu trainieren“, erklärt Kimeswenger. Bei seltenen Erkrankungen gibt es aber freilich niedrige Fallzahlen und somit nur kleine Datenmengen. Bei der vielbeachteten dritten künstliche-Intelligenz-Welle, die etwa 2012 aufgekommen ist, konnte man zunächst mit seltenen Dingen und Ereignissen nichts anfangen, sagt Günter Klambauer vom Institut für Machine Learning der Universität Linz: „Damals hat es etwa 1000 Fotos von Autos, jeweils 1000 Bilder von Hunden und Katzen, und 1.000 Beispiele für Menschen gebraucht, damit Bildklassifikationen durch maschinelles Lernen möglich war“. Mittlerweile gäbe es einen Trend, dass die Geräte auch seltene Sachen immer besser erkennen. Bei wenigen Beispielen sprechen die Experten von „Few shot learning“ (Lernen mit wenigen Versuchen) und teils können Maschinen mittels „Zero shot learning“ (Lernen ohne Versuch) sogar Phänomene klassifizieren, die ihnen nie zuvor untergekommen sind. „In der Medizin könnte man etwa Few-shot-learning Methoden anwenden, wenn man bei seltenen Erkrankungen nur drei Fälle hat, wo die DNA (Anm.: das Erbgut) verändert ist“, meint er. Nachsatz: „Few-shot-learning ist nämlich mittlerweile ziemlich stark geworden“. Auch Kimeswenger erklärt, dass bei seltenen Erkrankungen maschinelles Lernen bisher hauptsächlich angewendet wurde, um ursächliche Mutationen auf dem Erbgut zu erkennen. „Vereinzelt wird es aber auch schon für die Diagnose basierend auf Bilddaten unterschiedlicher Art genutzt“, sagt sie.
Die Netzhaut als Guckloch in den Körper
Bilder der Retina (Netzhaut) verwendet Hrvoje Bogunovic von der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der Medizinischen Universität Wien vor allem, um Maschinen lernen zu lassen, die (leider nicht so seltene) koronare Herzkrankheit zu diagnostizieren. Anhand der kleinen Äderchen in der Netzhaut könne man nämlich den Zustand des kardiovaskulären Systems (Herz-Kreislaufsystems) einschätzen. „Wenn die Datenbanken größer und vor allem mehr divers werden, wird es aber ein Fortschreiten hin zu seltenen Erkrankungen geben“, meint er. In der Regel würden die Datensätze, und zwar vor allem jene, die für die Forscher gut zugänglich sind, nur einen kleinen Teil der Bevölkerung abdecken: Nämlich jene Menschen, die aus irgendeinem Grund zugestimmt haben, an einer medizinischen Studie teilzunehmen. „Das wird sich mit der Zeit aber ändern, und ich rechne damit, dass Künstliche-Intelligenz-Systeme in Zukunft mit ausgeglicheneren Datensätzen trainiert werden können, die die reale Bevölkerung repräsentieren.“
Künstliche Intelligenz verfolgt epileptische Anfälle
Der Neurologe Tim von Oertzen von der Klinik für Neurologie 1 am Kepler Universitätsklinikum in Linz untersucht, ob man mit Hilfe eines Sensornetzwerks und künstlicher Intelligenz epileptische Anfälle feststellen oder sogar vorhersagen kann. „Die meisten dieser Erkrankungen sind seltene Erkrankungen“, erklärt er. Sie können erblich bedingt sein, durch Stoffwechselstörungen oder Entwicklungsstörung des Gehirns hervorgerufen werden, aber auch Folgen von Schlaganfall, Hirnentzündung, Demenz oder Hirntumoren sein. Im Projekt „Epilepsia“ misst er mit Kollegen die Bewegungen und andere „Vitalparameter“ wie Atem- und Pulsfrequenz, Blutdruck und die Körpertemperatur. „Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die Daten auf wiederkehrende Muster während eines Anfalles untersucht“, sagt der Mediziner: Damit könnte man nicht nur Anfälle erkennen, die bei manchen Patienten oft unbemerkt vonstattengehen, sondern sie vielleicht sogar vorhersehen und dementsprechend handeln – indem man zum Beispiel für die Sicherheit der Betroffenen sorgt.

Medikamentenentwicklung mittels künstlicher Intelligenz
Der erste Schritt zu neuen Medikamenten ist oft die Herstellung möglichst vieler neuartiger Wirkstoff-Substanzen. Bestimmte chemische Reaktionen sind dafür schon altbewährt, andere wurden noch kaum oder gar nicht erfolgreich im Labor durchgeführt. „Wir ließen ein künstliches neuronales Netz, und zwar ein sogenanntes Hopfield Netz lernen, welche chemische Strukturen und welche chemischen Reaktionen zusammenpassen“, berichtet Klambauer. Damit wäre man von fast Null Prozent Vorhersagequalität, also kompletter Unfähigkeit des Systems, chemische Reaktionen vorherzusagen, auf dreißig bis vierzig Prozent Voraussagewahrscheinlichkeit gekommen. „Das heißt, wir haben dadurch manche in der chemischen Synthese bisher noch nicht bekannten Reaktionen korrekt vorhersagen können“, so der Forscher.
Neuronale Netzwerke für Einzelanwendungen
„Hauptsächlich verwendet man für solche Anwendungen neuronale Netzwerke, die schon vortrainiert sind und macht nur mehr das Feintuning für die spezielle Aufgabe, zum Beispiel eine seltene Erkrankung zu erkennen“, erklärt Kimeswenger „Es ist derzeit keine breite künstliche Intelligenz für medizinische Bereiche, also keine ‚Gesundheitsbereich-KI‘ verfügbar“, so Klambauer. Also müssen einzelne Maßlösungen erstellt werden, um Blutgefäßchen auf Augenhintergrundbildern zu analysieren, Tumorzellen auf Gewebeschnitten zu erkennen und Hauterkrankungen anhand von Handybildern zu identifizieren. Neben Bilder können solche neuronalen Deep Learning Netze auch „tabulare Daten“ verarbeiten, also medizinisch relevante Charakteristika wie das Alter, Geschlecht, und auch Zeitserien von Elektrokardiogrammen (EKGs) und Elektroenzaphalogrammen (EEGs), sagt der Forscher. Auch hier muss die künstliche Intelligenz jeweils speziell für die Aufgabe geschult werden.
Nicht nur die Anwendungssysteme, auch die Forschung ist in Österreich leider „nicht sehr gebündelt“, erklärt Klambauer: „Es gibt sehr viel Forschung an künstlicher Intelligenz und auch sehr viele Mediziner, die offen dafür sind, sie einzusetzen, aber es gibt noch keine größeren Forschungszentren oder -cluster“. Derzeit würde man versuchen, eine vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF geförderten Exzellenzcluster zum Thema künstliche Intelligenz ins Leben zu rufen. Die Mediziner und medizinische Universitäten wären hier zwar nicht direkt im Forschungsnetzwerk involviert, sollten aber wichtige Forschungspartner werden, meint er.
Vereinte virtuelle Kräfte gegen seltene Erkrankungen
In Österreich und der EU gibt es aber massive Anstrengungen, digital die Kräfte gegen seltene Krankheiten zu bündeln: Beim „gemeinsamen europäischen Programm für seltene Erkrankungen“ (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) wird unter anderem der Aufbau einer virtuellen Plattform für Daten und Ressourcen umgesetzt. Dort werden Forscher unterstützt, an anonymisierte Patientendaten zu kommen, um Medikamente und Therapien gegen die verschiedensten seltenen Erkrankungen zu entwickeln, erklärt Dieter Hayn von der Digital Health Gruppe des Center for Health and Bioresources am AIT Austrian Institute of Technology in Graz. Zudem werden Biobanken an die virtuelle Plattform ebenso „angedockt“ sein wie Datenbanken zu medizinischen Studien und beispielsweise ein Portal zur Kinderkrebsforschung, das am AIT aufgebaut wird, berichtet er: „Dort geht es darum, sowohl klinische Daten als auch Biobanken und genomische Daten zu verlinken und gemeinsam zu sammeln.“ Die Plattform vernetzt auch europäische Referenz-Netzwerke, über die zum Beispiel die Mediziner eines kleinen Provinzkrankenhauses für einen Patienten mit einer seltenen Erkrankung die Experten aus großen Zentren kontaktieren, die über die nötige Erfahrung verfügen, und „niederschwellig Expertise sowie eine ärztliche Zweitmeinung einholen, etwa per Videocall“.
Ein Pass gegen Spätfolgen von Kinderkrebstherapien
„Krebs bei Kindern ist glücklicherweise eine seltene Erkrankung, aber es gibt auch schwere Verläufe, die mit entsprechender Behandlung wie Chemotherapie, Chirurgie, Immuntherapie und Knochenmarktransplantationen beantwortet werden müssen“, sagt Günter Schreier vom AIT. Manche Therapien haben späte Auswirkungen, denen man mit Vorsorgeuntersuchungen begegnen sollte. Zum Beispiel zeige sich bei Mädchen nach einer Strahlentherapie gegen einen Tumor im Brustbereich später ein erhöhtes Brustkrebs-Risiko und deshalb sollten sie als Frauen dementsprechend öfter ein Screening durchführen lassen. „Außerdem ist es durch die geringen Fallzahlen schwierig, genug Erfahrung zu sammeln, um gezielte Strategien gegen diese späten Effekte zu entwickeln“, erklärt er: „Drittens sind die meisten Mechanismen im Gesundheitswesen nicht dafür ausgelegt, über Zeiträume von mindestens zehn bis dreißig Jahren Nachsorgeuntersuchungen und Beobachtungen zu machen.“
Darum etabliert man in Österreich und fünf anderen europäischen Ländern einen Survivorship-Passport (Langzeitüberlebenden-Pass) für Kinder, die eine Krebsbehandlung bekommen. „Den Patienten und dem Gesundheitspersonal wird damit ein Dokument in die Hand gegeben, in dem die Zusammenfassung der vorangegangenen Therapie aufgezeichnet ist“, so Schreier. Zugleich wird für jedes Behandlungsprofil ein Pflegeplan (Care Plan) mit Empfehlungen für Nachbehandlungen und Vorsorgeuntersuchungen erstellt. „Der Patient kann dadurch in seiner elektronischen Gesundheitsakte nachsehen, was gut für ihn wäre, und sich um die empfohlenen Untersuchungen kümmern“, erklärt er: „Durch den Survivorship-Passport wird zudem eine weiter Hürde überwunden, nämlich dass die Pädiatrie bei 18-Jährigen endet und die Patienten dann in eine andere medizinische Domäne eintreten, wobei oft Information verloren geht.“ Hierzulande wird der Survivorship-Passport zunächst am St. Anna Kinderspital und an der St. Anna Kinderkrebsforschung (CCRI) umgesetzt, was bis Ende des Jahres realisiert werden soll, so der Experte: „Anschließend werden wir die weiteren Kinderkrebs-Zentren in Österreich an Bord holen.“
