„Oida, wos geht mi des an?“ im Dialog mit Berufsschülern
Lehrlinge sowie Berufsschülerinnen und -schüler sind lange nicht als eigene Zielgruppe der Wissenschaftskommunikation angesprochen worden. Das Projekt “Oida, wos geht mi des an?” geht hier neue Wege. Projektleiter Johannes Starkbaum, Sozialwissenschafter am Institut für Höhere Studien (IHS), erzählt im APA-Science-Interview über Erfahrungen und Erkenntnisse.

APA-Science: Bei Ihrem Projekt handelte es sich um ein Pilotprojekt der Wissenschaftskommunikation für Lehrlinge sowie Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Wie war die Zusammenarbeit mit dieser Gruppe?
Johannes Starkbaum: Zunächst einmal haben wir wirklich große Unterstützung auf allen Ebenen gehabt, bei der Schulkoordination, den Direktorinnen und Direktoren und den Lehrkräften, aber auch bei den Schülerinnen und Schüler selbst. Das hat uns Zugang zum Feld eröffnet.
Die Zusammenarbeit mit den Berufschülerinnen und -schülern an sich funktioniert gut, wenn das Format gut auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Dann kann man Interesse wecken und Wissenschaft vermitteln. Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei Berufsschülerinnen und -schülern zwar um Jugendliche, aber um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Die Berufssparten der unterschiedlichen Schulen können ja sehr unterschiedlich sein.
Was braucht es, um erfolgreich an diese heterogene Gruppe vermitteln zu können?
Für viele Jugendliche ist Wissenschaft etwas, das abstrakt und weit weg ist. Deswegen ist es problematisch, wenn man sehr allgemein von Wissenschaft spricht. Es braucht in der Wissenschaftskommunikation generell konkrete Bilder, auch weil die Wissenschaft sehr vielfältig ist. Es ist daher ganz wichtig, dass man einerseits über klare Felder der Wissenschaft spricht. Das haben wir anhand des Beispiels Klimawandel gemacht und Kommunikationsmaßnahmen an diesem Beispiel aufgehängt.
Wir haben andererseits gesehen, dass es notwendig ist, an den Interessen und Lebensbedingungen der Jugendlichen anzuknüpfen, damit das Thema für sie greifbar und interessant ist. Das hängt natürlich auch mit dem Kontext ihrer Berufsschule, also mit der Ausbildung, die sie gerade machen, zusammen.
Es macht auch keinen Sinn, wenn erwachsene Wissenschafterinnen und Wissenschafter versuchen, Jugendsprache zu verwenden – auch wenn wir „Oida“ in unserem Projekttitel haben. Prinzipiell fühlen sich die Jugendlichen in der Kommunikation dann nicht ernstgenommen. Genauso wenig ist es sinnvoll, mit zu vielen Fremdworten um sich zu werfen. Zu guter Letzt war es bei unserem Thema der Klimakrise auch wichtig, einen optimistischen Zugang zu haben und eher positive Wege zu finden, um die Klimakrise zu adressieren, als nur über negative Aspekte zu reden.
Wie kann man im Schulkontext auf Augenhöhe kommunizieren?
Wir haben als Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die an die Schule kommen, eine Sonderrolle: Wir sind keine Lehrer, und es ist klar, dass wir zu Besuch sind. Die Kommunikation auf Augenhöhe ist zunächst trotzdem schwierig, auch weil es ein stereotypes Bild von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus den Medien gibt. Aber aus dem heraus ergibt sich dann auch ein starkes Interesse an uns als Personen. Wenn man das nutzt, um in den Dialog zu treten, sehen die Jugendlichen schnell, dass wir als Personen und mit dem, was wir machen – also Wissenschaft – gar nicht so abstrakt sind, sondern das dies nachvollziehbar und auch anknüpfungsfähig ist an das, was sie an der Berufsschule in ihrer Ausbildung lernen.
Gibt es Aussichten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit?
Aus unserer Sicht ist das definitiv geplant. Wir sondieren gerade Möglichkeiten und die Finanzierung muss noch aufgestellt werden, aber wir möchten das gerne machen. Das Projekt war ein wichtiger Startpunkt. Aber wir haben es mit einer großen, heterogenen Zielgruppe zu tun. Es gibt noch viel auszuprobieren. Wir haben auch viel dazu gelernt.
Zum Beispiel?
In einem zukünftigen Projekt würden wir etwa gerne mit den Jugendlichen zusammen die Kommunikationsmaßnahmen entwickeln, also viel stärker mit ihnen in den Austausch gehen.
Im Rahmen des Projektes ging es auch um die Erforschung der Zielgruppe. Gibt es schon erste Ergebnisse?
Die Analyse läuft noch. Man sieht aber jetzt schon, dass es generell eine hohe Zustimmung und viel positives Feedback gegeben hat. Ich glaube es ist zentral, dass es deutlich höhere Zustimmung bei den interaktiven Formaten – bei denen die Jugendlichen aktiv mitdiskutieren konnten – gab. Daran muss man anknüpfen, wenn man mit diesen Gruppen anhand von Wissenschaft in Dialog treten will.
In Österreich sind nach den Euro- und ÖAW-Barometer-Ergebnissen viele Projekte angelaufen. Gibt es Ihrer Ansicht nach noch Leerstellen oder Defizite?
Hier passiert jetzt einiges, und die Maßnahmen werden breiter aufgestellt. Es ist gut, dass unterschiedliche Schultypen bespielt werden und versucht wird, eine stärkere regionale Steuerung hineinzubekommen – also Wissenschaftskommunikation über alle Regionen und unterschiedliche Stadtteile zu verteilen und anzupassen. Ich glaube, in diese Richtung muss weiterhin mehr passieren. Bei all diesen Maßnahmen ist es sehr wichtig, keinen Automatismus laufen zu lassen. Die Maßnahmen müssen gut koordiniert und evaluiert sein.
Inwiefern?
Wo finden jetzt tatsächlich Maßnahmen statt? Wo gehen Wissenschafterinnen und Wissenschafter in die Schulen? In welche Schultypen und welchen Hintergrund haben die Forschenden? Es macht einen großen Unterschied, ob jemand aus Natur– oder aus den Geistes- und Sozialwissenschaften an die Schulen geht. Wie sich das verteilt, muss gut aufgezeichnet werden, um eine möglichst breite Verteilung sicherzustellen. Es soll keinen Blindflug geben.
Die Wissenschaftskommunikationsagentur „science communications“ und Sozialwissenschafter und -wissenschafterinnen des Instituts für Höhere Studien (IHS) haben das Projekt „Oida, wos geht mi des an?“ entwickelt, um Lehrlinge, Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der Wissenschaftskommunikation als eigenständige Zielgruppe zu erfassen und zu erforschen. Die Förderung kam von der Stadt Wien. Es wurden Ausstellungen organisiert sowie Unterrichtseinheiten von jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern abgehalten. Zum Abschluss gab es eine große Wissenschaftsshow mit Physiker Werner Gruber im Theater Akzent.
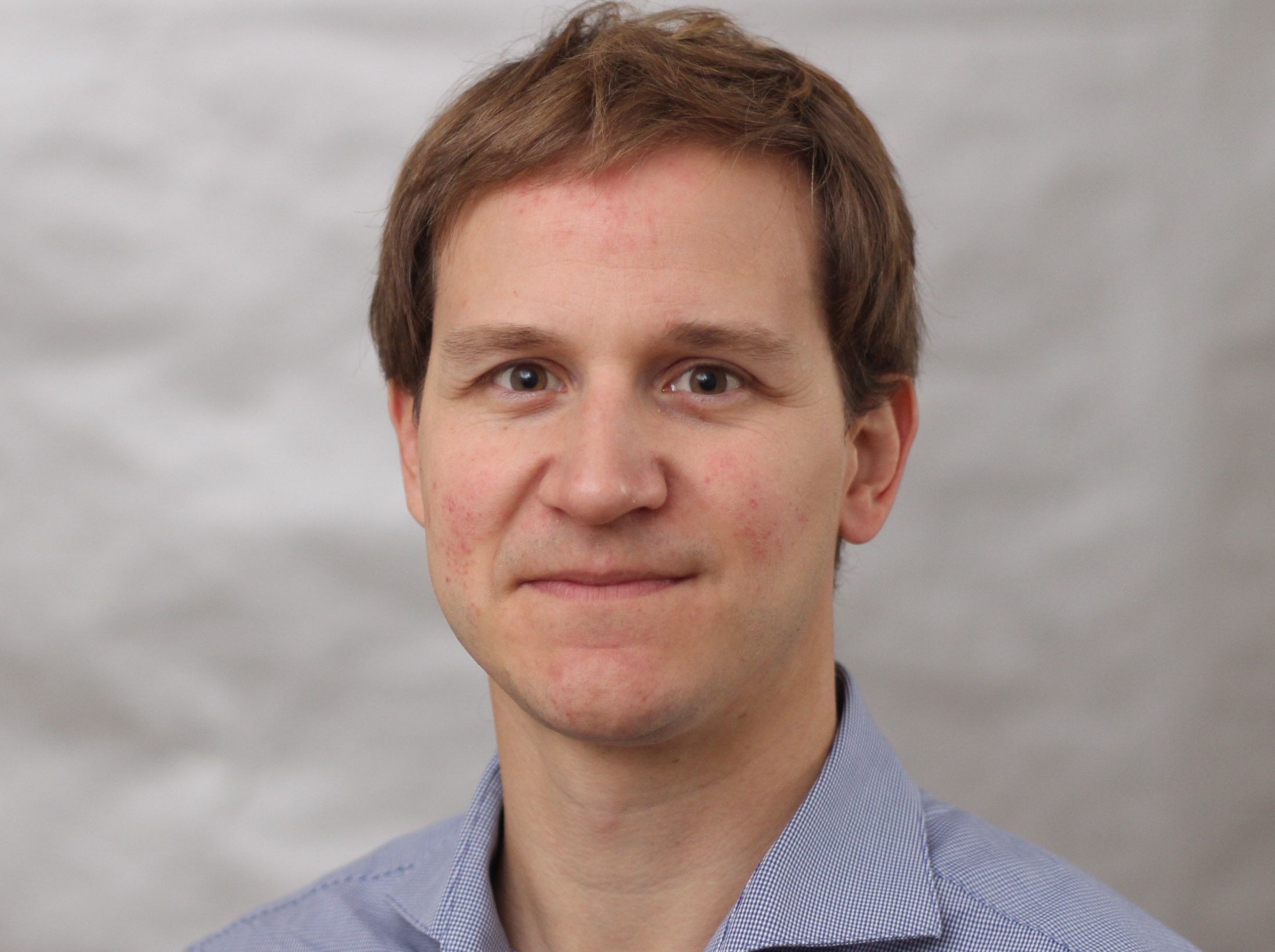 Johannes Starkbaum ist Senior Researcher in der Forschungsgruppe „Science, Technology and Social Transformation“ am Institut für Höhere Studien (IHS). Aktuell forscht er zu Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftskommunikation sowie zum Zusammenwirken von Wissenschaft und Gesellschaft in den Bereichen personalisierte Medizin und Automobilität.
Johannes Starkbaum ist Senior Researcher in der Forschungsgruppe „Science, Technology and Social Transformation“ am Institut für Höhere Studien (IHS). Aktuell forscht er zu Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftskommunikation sowie zum Zusammenwirken von Wissenschaft und Gesellschaft in den Bereichen personalisierte Medizin und Automobilität.
