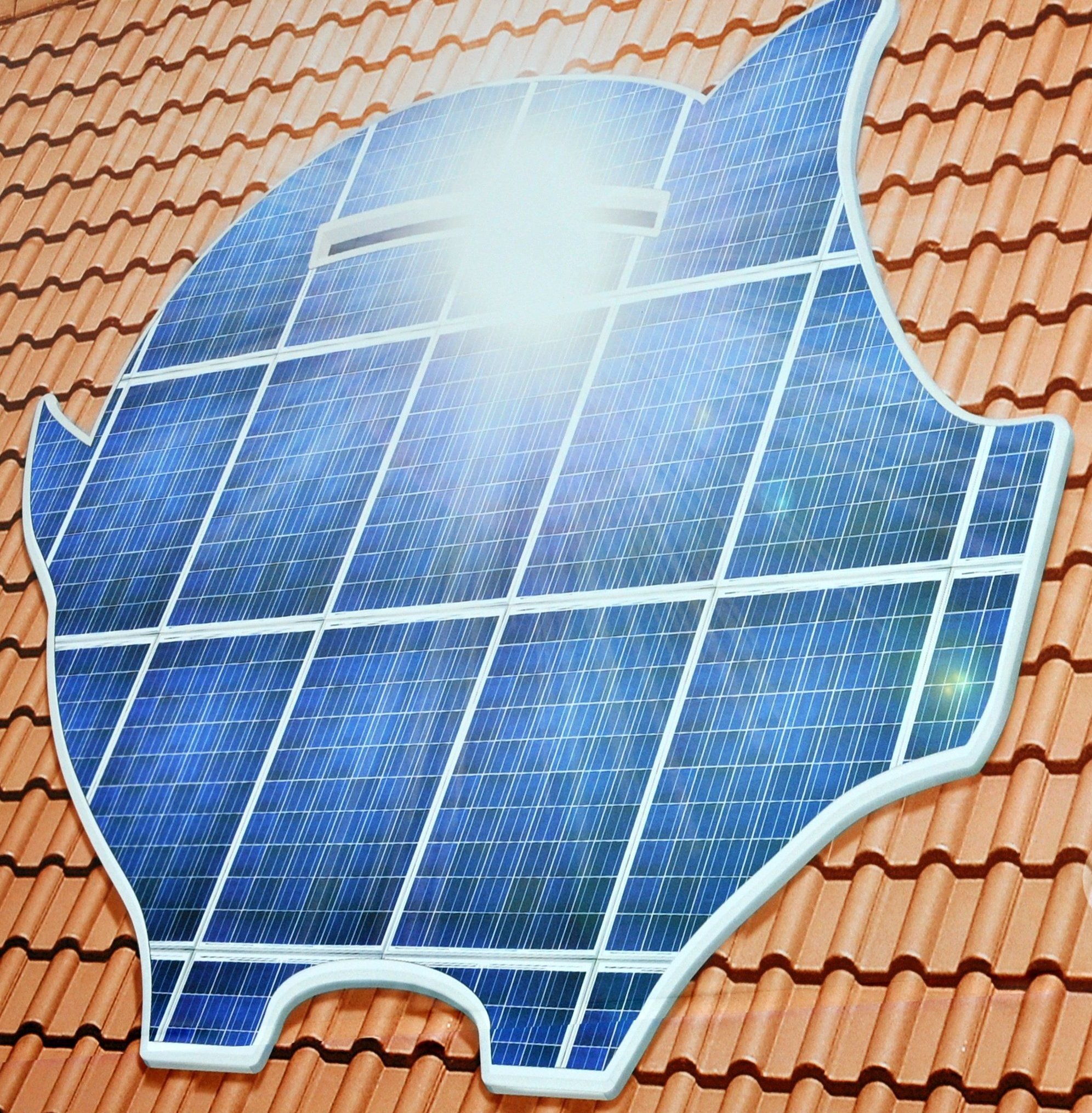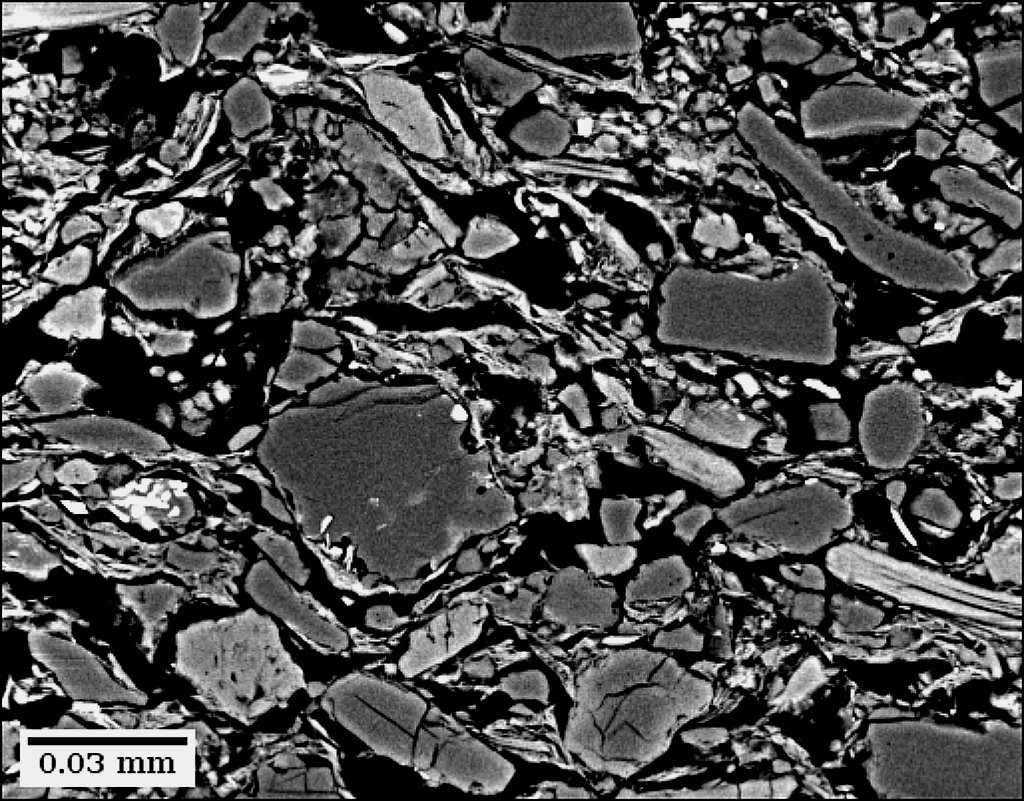Der Bausektor gilt als eher träger Tanker. Das ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung in Zeiten von Klimawandel, Digitalisierung, Rohstoffkrise und gesellschaftlichen wie demografischen Veränderungen. Inzwischen kommt aber etwas Bewegung in die Sache – das Fundament dafür ist die Forschung.
„Ein Schnellboot ist die Bauindustrie sicherlich nicht. Aber so schlecht, wie sie immer dargestellt wird, ist sie auch nicht“, verweist Ralph Stöckl vom Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der Technischen Universität (TU) Graz auf zahlreiche aktuelle Aktivitäten. Wo gibt es Innovationen in der Branche? Welche neuen Technologien und Materialien werden bereits eingesetzt, sind in Entwicklung oder könnten in Zukunft eine Rolle spielen? Wie lässt sich die Digitalisierung nutzen? Und welchen Einfluss haben Klimawandel, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft? APA-Science hat sich umgehört.
Branche im (Klima-)Wandel
Um Gebäude an die Erfordernisse des Klimaschutzes anzupassen, ist die ganze Baubranche im Wandel, erklärt Azra Korjenic vom Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie der Technischen Universität (TU) Wien: „Wir wissen, dass das Bauwesen einer der Wirtschaftszweige mit den größten Materialflüssen, sowie dem größten Energie- und Ressourcenverbrauch ist, und deshalb gibt es hier viel zu tun.“ Von der Entnahme der Materialien in der Natur, über die Transportwege, die Bearbeitung, die Nutzungsphase des Gebäudes und die Wiederverwertung müsse man alles inkludiert betrachten und planen. Außerdem müsse mehr wiedertrennbar gemacht und recycelt werden.
Vor fünf bis zehn Jahren hatte die Bauwirtschaft den Klimawandel noch gar nicht im Fokus, nun muss sie sich aber ganz genau überlegen, wie sie das „Treibhausgas-Budget“ investiert, das ihr laut Weltklimarat zusteht, erklärt Alexander Passer von der Professur für Nachhaltiges Bauen am Institut für Tragwerksentwurf der TU Graz. Die Klimapolitik muss in Zukunft im Hinblick auf die Klimaziele von Paris eine „härtere Sprache sprechen als die Budgetpolitik“, meint er. Aktuell entwickelt Passer mit seiner Forschungsgruppe Rechenmodelle, um Treibhausgas-Bilanzen für den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes zu ermitteln.
Am Baustellenbetrieb könne man Einiges der zehn Prozent Treibhausgasemissionen einsparen, für die die Bauindustrie weltweit verantwortlich ist, fanden die Baubetriebsforscher Leopold Winkler und Maximilian Weigert vom Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der TU Wien heraus. Die von ihnen veröffentlichte Studie „CO2 neutrale Baustelle“ zeigt, dass einige technische und organisatorische Maßnahmen die CO2-Last bereits um die Hälfte senken (siehe Gastbeitrag „Auf dem Weg zur CO2-neutralen Baustelle“).
Fokus auf Bestandssanierung
„Die großen Schritte, um die Klimaziele im Bausektor zu erreichen, sind aber nicht im Neubau, sondern bei der Bestandssanierung zu setzen“, sagt Markus Leeb vom Forschungsbereich Smart Building and smart City der Fachhochschule (FH) Salzburg. Mit Kollegen hat er ein Forschungsprojekt namens „Zero Carbon Refurbishment II (ZeCaRe)“ in einer Salzburger Wohnsiedlung aus den 1980er Jahren durchgeführt, die dadurch klimaneutral gestaltet wurde. Man hat dort nicht nur ein erneuerbares Energiesystem mit Photovoltaik, Abluftwärmerückgewinnung, Abwasserrückgewinnung und Kesselpellets installiert und das Gebäude wärmeisoliert. Damit die Mobilität der Bewohner umwelt- und klimaschonender werden kann, gibt es dort nun eine große Radgarage, Carsharing und Lastenfahrräder.
„In Österreich leben die meisten Menschen in Einfamilienhäusern“, so Bernhard Sommer von der Universität für angewandte Kunst (Die Angewandte) in Wien. Beim Heizen ist dies ein Nachteil, denn es ist aufwendiger, sie etwa an Fernwärmenetze anzuschließen, und im Vergleich zum Volumen haben sie eine recht große Oberfläche, über die Wärme verloren geht. „Bei der Energieproduktion durch Solarpaneele ist die vergleichsweise große Dachfläche jedoch ein Vorteil, und auch auf der Wiese rundherum kann man wunderbar Wärmepumpen aufstellen oder Geothermie nutzen“, sagt er: „Diese Möglichkeiten haben wir im innerstädtischen Bereich nicht.“
- Der Bausektor ist nicht gerade geprägt von schnellen Umbrüchen, steht aber vor großen Herausforderungen, was die „Gebäude der Zukunft“ betrifft.
- Innovative Ansätze entwickeln sich vor allem in den Bereichen Klima & Energie, Materialien, Digitalisierung und Raumplanung.
- In der Umsetzung und Anwendung gibt es einzelne Vorreiter und Pilotprojekte, oft ist aber die Wirtschaftlichkeit (noch) nicht gegeben.
Programm Stadt der Zukunft.
Programm Haus der Zukunft
Studie „CO2 neutrale Baustelle“
Projekt „Zero Carbon Refurbishment II (ZeCaRe)“
Dekarbonisierungs-Roadmap der Zementindustrie
Digital Findet Stadt – die Innovationsplattform für Digitalisierung am Bau